 Das bundesweit erscheinende BTB Magazin informiert 10 Mal im Jahr über aktuelle Themen und Aktivitäten der Landesbünde, von neuen Entwicklungen auf Bundesebene und berichtet von Ergebnissen aus der Gremienarbeit. Zudem gibt es regelmäßig fachliche Themenschwerpunkte aus den technischen Fachverwaltungen.
Das bundesweit erscheinende BTB Magazin informiert 10 Mal im Jahr über aktuelle Themen und Aktivitäten der Landesbünde, von neuen Entwicklungen auf Bundesebene und berichtet von Ergebnissen aus der Gremienarbeit. Zudem gibt es regelmäßig fachliche Themenschwerpunkte aus den technischen Fachverwaltungen.
Der Rechtsschutz ist und bleibt ein wichtiges Feld der gewerkschaftlichen Arbeit. Deshalb gewährt der BTB Bund seinen Mitgliedern auf Antrag berufsbezogenen Rechtsschutz. Grundlage hierfür ist die Rahmenrechtschutzordnung (RRSO) des dbb. Weitere Informationen zur RRSO finden Sie auf den Internetseiten des dbb.
Gemäß der Rahmenrechtschutzordnung hat ein Mitglied, das ein Verfahren mit dem Rechtsschutz des dbb NRW führen will, zunächst über seine Mitgliedsgewerkschaft einen Antrag auf Rechtsschutzgewährung zu stellen und die Entscheidung der Rechtsabteilung des dbb abzuwarten. Sollte es sich vorab an einen Rechtsanwalt wenden, muss das Mitglied damit rechnen, die entsprechenden Kosten selber tragen zu müssen.
Grundsätzlich soll Rechtschutz nur durch die Juristen des dbb geführt werden, wobei besondere Ausnahmen für Straf- und Disziplinarverfahren gelten.
Die Rechtsexperten des dbb sind Volljuristen, die Sie im Falle des Falles bei rechtlichen Schwierigkeiten, die dienstlich auftreten, beistehen.
Wenn Sie einen Antrag auf Rechtsschutz stellen möchten, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus. Die Angaben werden datenschutzkonform ausschließlich den Rechtsschutzbeauftragten des BTB Bund übermittelt.
Antrag auf berufsbezogenen Rechtsschutz
Haben sich bei Ihnen persönliche Daten oder z. B. auch die Dienststelle geändert? Dann können Sie dies ganz einfach mit dem nachfolgenden Formular der Bundesgeschäftsstelle mitteilen.
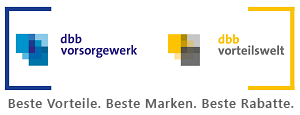
Das dbb vorsorgewerk als Serviceeinrichtung des dbb beamtenbund und tarifunion bietet den Mitgliedern der 40 Mitgliedsgewerkschaften und der 16 Landesbünde, die unter dem Dach des dbb zusammengeschlossen sind, besonders günstige und attraktive Mehrwertangebote. Dabei ist das dbb vorsorgewerk seit seiner Gründung 2002 der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitglieder als satzungsgemäßem Auftrag des dbb verpflichtet.
Viele dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen haben sich für die mit speziell ausgehandelten Beitragsnachlässen sowie zahlreichen Leistungs- und Servicevorteilen ausgestatteten Angebote entschieden. Zahlreiche Tarife werden immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet. Die Partner des dbb vorsorgewerk sind besonders ausgewählte Unternehmen, die schon vom Grunde her mit sehr leistungsstarken Angeboten überzeugen und darüber hinaus eine besondere Verbundenheit zum öffentlichen Dienst mit sich bringen.
Zu den aktuellen Kooperationspartnern gehören:
![]()
DBV Deutsche Beamtenversicherung
in den Sparten Leben, Kranken, Haftpflicht, Hausrat und Unfall

Bausparkasse Wüstenrot
in der Sparte Bausparen

BBBank
mit dem Girokonto, Baufinanzierungen, Investmentfonds und Geldanlage
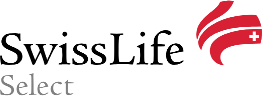
Swiss Life Select,
die eine kompetente Beratung und eine Vielzahl an Rabatten und Vergünstigungen über das dbb vorsorgewerk aus einer Hand bietet.
Die Angebote beinhalten in den gemeinsam angebotenen Sparten speziell ausgehandelte
Rabatte von bis zu 50 % sowie zahlreiche Leistungs- und Servicevorteile
exklusiv für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften des dbb und ihre Angehörigen.
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...
- werden Ihre Interessen von einer durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.
- können Sie selbst im Kreis interessierter Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen Dienstes beitragen.
- werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen und über jede Entwicklung im öffentlichen Dienst bestens informiert.
- ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtlichen und tarifvertraglichen Fragen sicher.
- genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen Rechtsstreitigkeiten.
- stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.
- können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen.
- Die Straßen, Brücken, Schienen, Tunnel, Kanäle und Flüsse stellen in einer mobilen und modernen Gesellschaft die Lebensadern dar. Adern durch die die Zeit pulsiert und über die Güter unserer Gesellschaft an ihr Ziel gelang.
- Hochbauten jeder Gesellschaft bezeugen die Kultur und stellen die aktuellen Entwicklungen dar. Bauwerke, sie sind die Zeitzeugen der Epochen und geben einem Staat, einer sich wandelnden Gesellschaft ein Gesicht.
- Neue Technologien, politische Einflüsse, das Selbstverständnis des Staates für sich und seine Bürgerrinnen und Bürger werden in den Bauwerken konserviert und somit widergespiegelt.
- Die Förderung der Kunst am Bau schafft eine unverwechselbare Identität der Plätze und Gebäude. Sie gibt den Menschen die Möglichkeit Kunst im Alltag zu erleben.
- Bauwerke bieten Gestaltungsmöglichkeiten für soziale, kulturelle, ökologische und ökonomische Belange des Staates und seiner Bürger.
- In Bauwerken in staatseigenem Besitz können sich unsere Pfeiler der Gewaltenteilung unabhängig gegenüber fremden Einflüssen auf ihre Aufgaben konzentrieren und entfalten.
- Öffentliche Bauwerke sind nicht nur Nutzungseinrichtungen. Sie ermöglichen erst die gesamte Bandbreite staatlichen Handelns, von der klassischen Verwaltung über Strafvollzug, Forschung und Lehre, Wissenschaft und Kultur, bis hin zu Aufgaben der Landesverteidigung.
Stand 2011
Arbeitskreis Bauverwaltungen
Thesen und Zielvorstellungen des BTB zur Verkehrspolitik
Ein leistungsfähiges Verkehrswesen ist Grundlage unserer Strukturpolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Vorrangiges Ziel der Verkehrsplanung muss sein, die Lebensqualität für die Bürger in unserem Land und ihre Umwelt zu erhalten, zu sichern und - wenn möglich - zu verbessern.
Die aktuellen und längerfristigen Probleme der Verkehrs-, Struktur- , Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Gesellschafts-, und Umweltpolitik sind komplexer Natur und können in letzter Konsequenz nicht isoliert betrachtet werden. Sie sind nur im Rahmen eines ausgewogenen verkehrspolitischen Gesamtkonzepts lösbar.
Die Wiedervereinigung Deutschlands ist gerade für die Verkehrspolitik eine große Herausforderung.
- Die verschiedenen Verkehrszweige (Straße, Schiene, Wasser, Luft) müssen sich partnerschaftlich ergänzen. Sie sollten ihren spezifischen Eigenarten entsprechend zum Nutzen aller unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und humanitären Einsatzgrenzen möglichst optimal zur Wirkung kommen. Den Ost-West-Verbindungen ist eine besondere Bedeutung zuzumessen.
- Der Verkehrsverbund ist zu fördern. Der Übergang von einem Verkehrssystem zum andern, insbesondere von der Straße zur Schiene, muss durch Anlage geeigneter Parkplätze und mit anderen verkehrstechnischen Mitteln verbessert werden.
- Das Leistungsangebot der Deutschen Bundesbahn AG ist den strukturellen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechend auszubauen. Es muss insbesondere sichergestellt werden, dass der Massengüterverkehr wieder von der Straße weg zur Schiene verlagert wird. Die derzeitigen Wettbewerbsverzerrungen, denen die Deutsche Bahn AG ausgesetzt ist, müssen beseitigt werden.
- Der öffentliche Personennahverkehr ist besonders in den Ballungsräumen zu fördern.
- Daneben muss das für den Individualverkehr das unverzichtbare Verkehrssystem "Straße" unterhalten und modernisiert werden. Straßenneubauten sollten vorrangig zur Ortsumgehung, zur Verkehrsberuhigung in eng bebauten Ortschaften, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, zur großräumigen Erschließung von Ballungszentren, und dort erfolgen, wo die Verkehrsdichte dies erfordert.
- Das öffentliche Straßennetz ist bundesweit durch ein Radwegenetz parallel zu bestehenden oder neu zu bauenden Bundes- , Landes- , Kreis- und Ortsstraßen oder über vorhandene Wirtschafts- oder Forstwege zu ergänzen.
- Das Wasserstraßennetz sollte zu einem europäischen Verbundsystem bei Güteabwägung mit anderen Verkehrssystemen weiterentwickelt werden. Auch hierbei dürfen ökologische Interessen nicht vernachlässigt werden.
- Der Luftverkehr sollte vorwiegend internationalen und globalen Verbindungen dienen. Zur Vermeidung von Fehlinvestitionen und Überkapazitäten ist ein besserer Verkehrsverbund inbesondere mit dem Schienen-Schnellverkehr dringend geboten.
- Bei allen Verkehrswegeplanungen und verkehrspolitischen Maßnahmen müssen die Interessen des Umweltschutzes unter Einschaltung der zuständigen Fachbehörden (Landschaftsbehörden, Ämter für Umweltschutz und Ökologie usw.) Berücksichtigung finden (Umweltverträglichkeits-Atteste, wissenschaftlich begründete ökologische Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in die Natur).
Eine über 40-Jährige Entwicklung der Dienstleistungsverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland hat gezeigt, dass der Weg vom Obrigkeitsstaat hin zum Dienstleistungsstaat gelungen ist. Daseinsvorsorge statt Obrigkeit ist angesagt.
Der Umfang staatlicher Aufgaben und Leistungen ist keine ein für allemal festgelegte Größe. Öffentliche Leistungen sind in erster Linie am Gemeinwohl orientiert und nicht an Rentabilitätserwägungen, die ein Privatunternehmen notwendigerweise berücksichtigen muss.
Für technische Fachverwaltungen bedeutet dies eine gelungene Mischung von Ausführung, Lenkung und Überwachung, die sich gegenseitig bedingen. Eine "Nur -Überwachung" ohne eigenes Tätigwerden in der Sache bedeutet in kürzester Zeit Verlust des Praxisbezugs und damit die Unfähigkeit zur Ausübung der hoheitlichen Funktion, die dem öffentlichen Dienst niemand absprechen will.
Wir wehren uns nicht gegen eine sachgerechte Überprüfung staatlicher Dienstleistungen. Allerdings müssen die Vorgaben objektiv formuliert sein. Man muss sorgfältig prüfen, welche Leistungen der Staat für seine Bürger auch zukünftig zu erbringen hat und auf welche man verzichten kann. Dabei gibt es sicher auch Bereiche, die besser und kostengünstiger in privater Hand betrieben werden können. Leider wird aber derzeit zum Schaden der Bürger ein großangelegter Ausverkauf öffentlicher Dienstleistungen betrieben. Das Modewort vom "Schlanken Staat" erweckt falsche Hoffnungen. Die Folgewirkungen sind noch nicht abzusehen.
Deswegen fordert der BTB, bei allen geplanten Privatisierungsmaßnahmen folgende Fragen zu berücksichtigen:
1. Ein dauerhaftes und flächendeckendes Leistungsangebot muss für jeden Bürger in gleichbleibender Qualität und zu vertretbaren Preisen gesichert sein. Das heißt:
Ist die Grundversorgung der Bevölkerung auch ohne Einschaltung der öffentlichen Hand in Zukunft gewährleistet?
2. Eine nachhaltige Entlastung der öffentlichen Haushalte muss sichergestellt sein.
Das heißt:
Ist ausreichend geprüft, dass weder der Steuerzahler noch der betroffene Bürger nach erfolgter Privatisierung mit höheren Kosten belastet werden?
3. Wirtschaftliche Chancen und Risiken müssen gerecht verteilt werden. Das heißt:
Ist garantiert, dass die privaten Tätigkeiten sich nicht nur auf gewinnbringende Bereiche konzentrieren, während die öffentliche Hand weiterhin die verlustbringende Grundversorgung sicherstellen muss?
4. Es dürfen keine privaten Monopole entstehen. Das heißt:
Ist der wirkliche Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern gewährleistet?
5. Durch Privatisierung darf kein Sozialabbau entstehen. Das heißt:
Ist sichergestellt, dass durch die geplante Privatisierungsmaßnahme den Versicherungsträgem keine Beiträge entgehen?
6. Bei Privatisierung muss die notwendige parlamentarische Kontrolle bestehen bleiben, denn auch bei Übertragung von Aufgaben aus der öffentlichen Verwaltung an Privatunternehmen bleibt die Verantwortung beim Staat. Das heißt:
Ist bei Privatisierung die Kontrolle der Aufgabenerfüllung durch Parlamente in Bund, Ländern und Gemeinden auch weiterhin gegeben, damit der Staat seiner Verantwortung gerecht werden kann?
Nur wenn alle diese Fragen bejaht werden können, kann auch der BTB einer Privatisierung in Teilbereichen nicht unbedingt entgegenstehen.
Die Probleme des ländlichen Raumes sind heute sehr vielschichtig.
Schlagwortartig seien genannt:
Soziale Probleme (Entvölkerung, mangelnde Auslastung der Infrastruktur, hohe Arbeitsbelastung der Landwirte), Probleme des Naturschutzes (Landschaftsverbrauch, intensive Landbewirtschaftung, Artenschwund, Erholungsdruck, Zersiedlung der Landschaft), Probleme des Boden- und Wasserschutzes (Verminderung der Bodenfruchtbarkeit, Kontamination der Böden, Wind- und Wassererosionen, Versiegelung von Flächen, Belastung des Grundwassers mit Nitrat und Pestiziden u.a.m.).
Zur großräumigen, dauerhaften und integralen Lösung der Probleme und zur sinnvollen Nutzungsentflechtung der verschiedenen Planungen und Interessen bietet sich auch heute die Flurbereinigung als ein neutrales und unabhängiges Bodenordnungsinstrument an.




